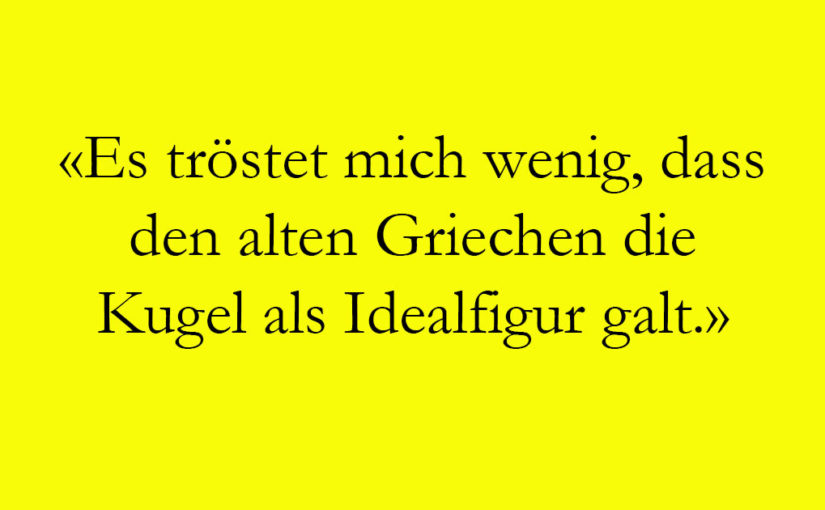«Übrigens» in den «Freiburger Nachrichten» vom 2. April 2020
Jetzt bereue ich es, keinen Hamster gekauft zu haben. Aber als alle anderen ihre Hamsterkäufe erledigten, habe ich nur den Kopf geschüttelt. Ich meine, wozu Hamster? Die Viecher taugen doch gar nicht als Notvorrat. Die muss man erst füttern, bevor man sie futtern kann. Und selbst bei kühler und trockener Lagerung halten die nicht ewig. Aber jetzt hätte ich schon schampar gerne so einen Hamster. Nicht als Sonntagsbraten, nein, um einfach wieder mal jemandem Wildfremden trotz Social Distancing herzhaft und gefahrlos die Pfote drücken zu können. Aber jetzt kriegt man Hamster nur noch schwarz im Internet, und das sind auch bloss aufgeföhnte Hausmäuse. Also Obacht.
Aber es fehlt mir schon, das Händedrücken, das Umarmen, das Küsschen-Küsschen-Küsschen. Ihnen nicht auch? Ich befürchte, wenn das alles mal vorbei ist, werde ich mit einem debilen Dauergrinsen durch die Strassen laufen und wie ein Irrer ausnahmslos alle umarmen, die bei drei nicht auf den Bäumen sind. Und wenn jemand «Me too» schreit, dann drück ich den auch gleich. Ich lasse mich nicht zweimal bitten.
Wenn das alles mal vorbei ist, dann gibt es statt drei klinisch reinen Begrüssungsküsschen hemmungslose Knutscherei. Alain Bersets Glatze werde ich küssen, wenn ich seiner habhaft werde. Und auch Daniel Koch vom BAG kriegt von mir einen dicken Schmatzer aufs Haupt.
Meine Eltern werde ich so oft und ausgiebig besuchen, dass sie sich irgendwann tot stellen, wenn ich klingle, weil sie finden, es sei eigentlich ganz gut gewesen, dass ich vor 20 Jahren ausgezogen sei.
Aufrichtig freuen werde ich mich über jeden Rentner an der Migros-Kasse, auch wenn er seine 17.95 mit mühsam hervorgeklaubten Fünfrappenstücken begleicht. Und sollte sich der Senior dann vielleicht sogar mit einem um Entschuldigung heischenden Blick zu mir umdrehen, werde ich sagen: «Was habe ich Sie vermisst.» Und ich werde es ernst meinen.
Ich esse mich eine Woche lang durch die Speisekarte meiner Dorfbeiz. Und wenn ich fertig bin, beginne ich wieder von vorn. Aber dieses Mal immer mit zwei Desserts.
Schamlos suhlen werde ich mich im Ikea-Bällebad und lauthals mitsingen, wenn sie sich im Radio wieder getrauen, Helene Fischers «Atemlos durch die Nacht» zu spielen.
Das alles werde ich tun. Oder auch nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur gottenfroh, wenn wir das alle einigermassen heil überstehen. Bleiben Sie gesund. Ich freu mich schon drauf, Sie zu drücken.