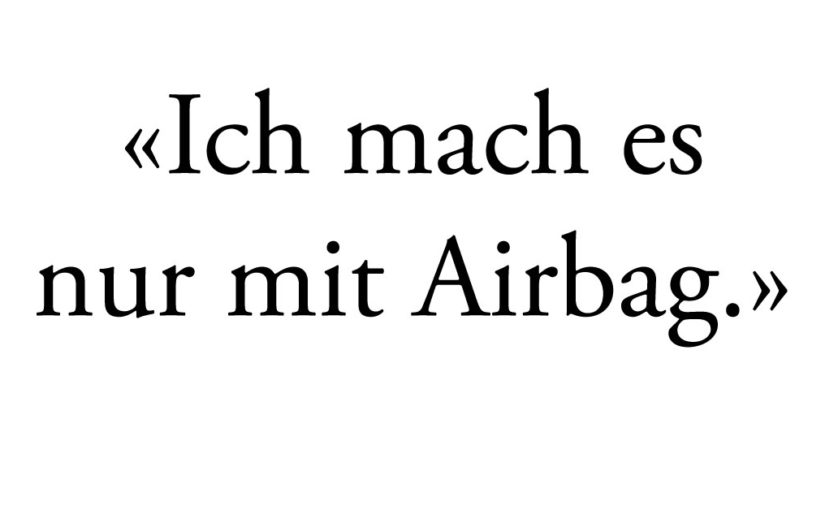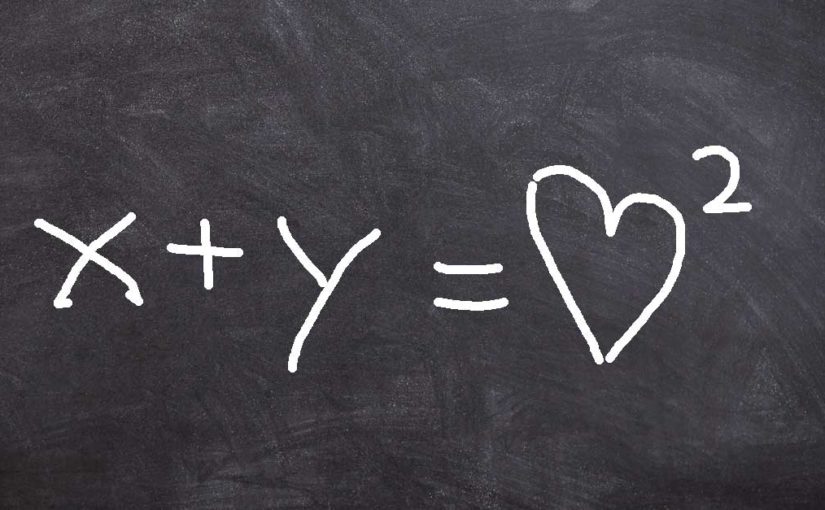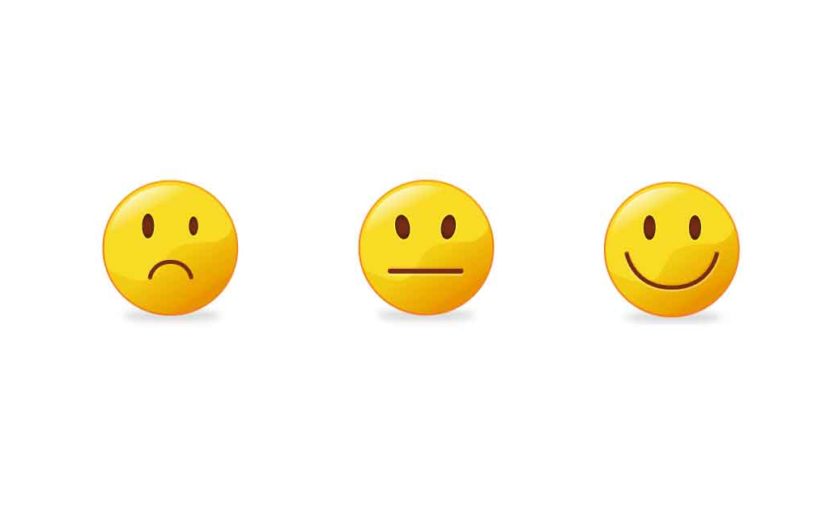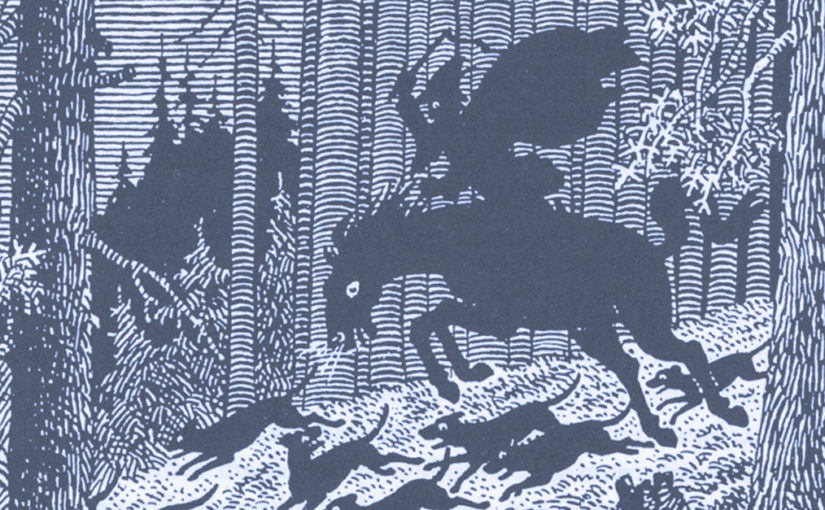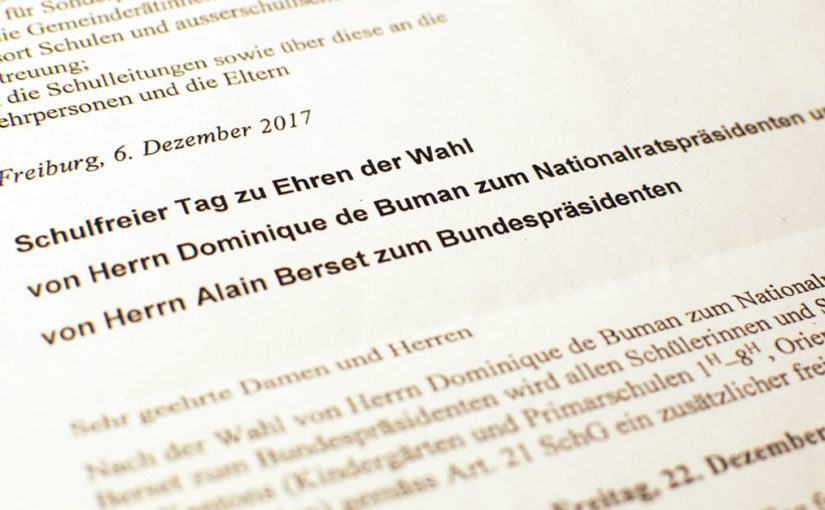«Übrigens» in den «Freiburger Nachrichten» vom 17. Februar 2014
In Schweden gelten ab diesem Sommer neue Verkehrsregeln. Vor dem Sex muss man seine Partnerin oder seinen Partner um Erlaubnis fragen. Ohne explizites Einverständnis kein Verkehr, sonst macht man sich strafbar. Ich finde, was die Schweden im Bett praktizieren, könnten wir doch auch auf unseren Strassen einführen: Bevor man ins Auto steigt, um die Umwelt flachzulegen, muss man erst ihre Erlaubnis einholen. Damit der Verkehr auch wirklich einvernehmlich ist. Sie können sich das nicht vorstellen? Bitte, ich helfe Ihrer Fantasie gerne auf die Sprünge.
«Hey, Umwelt, Schätzchen, ich hätte gerne Verkehr.» «Muss das sein?» «Geht nicht anders, ja.» «Na gut, wenn’s sein muss.» «Geil, aber ich sag dir lieber gleich, dass ich auf schmutzige Sachen stehe. Nicht dass du hinterher dann sagst, du hättest nicht gewusst, auf was du dich einlässt.» «Schmutzige Sachen?» «Fifty Shades of Blei, hähä, du weisst schon …» «Nein, ich kenn mich da nicht so aus.» «Stickoxid, Schwefeldioxid, Kohlenstoffmonoxid, Feinstaub, solches Zeug halt.» «Das tönt jetzt nicht grad sehr antörnend.» «Jetzt hab dich nicht so. Der Krebs jedenfalls, der findet das wahnsinnig erregend. Der kann nicht genug davon kriegen.» «Und das ist ganz sicher nicht gefährlich?» «Ach was, ich mach’s nur mit Airbag.» «Ok, ja dann.»
«Noch was, nicht dass du erschrickst: Ich komme schnell. Von 0 auf 100 in vier Sekunden.» «Na super.» «Keine Bange, Baby. Du kommst schon auf deine Rechnung, wenn ich den S-Punkt bearbeite.» «Den S-Punkt?» «Den Schleifpunkt. Dann kommst du schnell in die Gänge. Und wenn ich mal in Fahrt bin, stoppt mich so schnell keiner. Wirst schon sehen, wie ich dich zum Schwitzen bringe.» «Du bist also ein heisser Hengst?» «Nein, das sind die Treibhausgase. Und noch was: Ich bin ziemlich schwer. Kann also schon sein, dass dir die Luft wegbleibt. Und ich werde ziemlich laut, wenn ich voll abgehe.» «Hör auf, das ist ja widerlich.»
«Hey, Baby, bevor du jetzt den Rückwärtsgang einlegst: Willst du dir nicht mal meinen Hubraum ansehen?» «Du kotzt mich an. Hast du schon mal an Fussverkehr gedacht?» «Ist das so ne Thaimassage?» «Schwachkopf. Und ÖV?» «Ich steh nicht drauf, wenn mir andere dabei zuschauen.» «Machst du mir danach wenigstens Frühstück?» «Vergiss es, Baby. Wenn ich keinen Verkehr habe, steh ich nur unnütz rum und nehme Platz weg. Und ich saufe. Ziemlich viel sogar. Also, was ist jetzt mit uns zwei, Schätzchen?» «Wenn ich mir das so überlege, würde ich unterm Strassenstrich sagen: Vergiss es. Deinen Auspuff kannst du dir sonst wo hinstecken.»
Also ich finde das eine Überlegung wert.