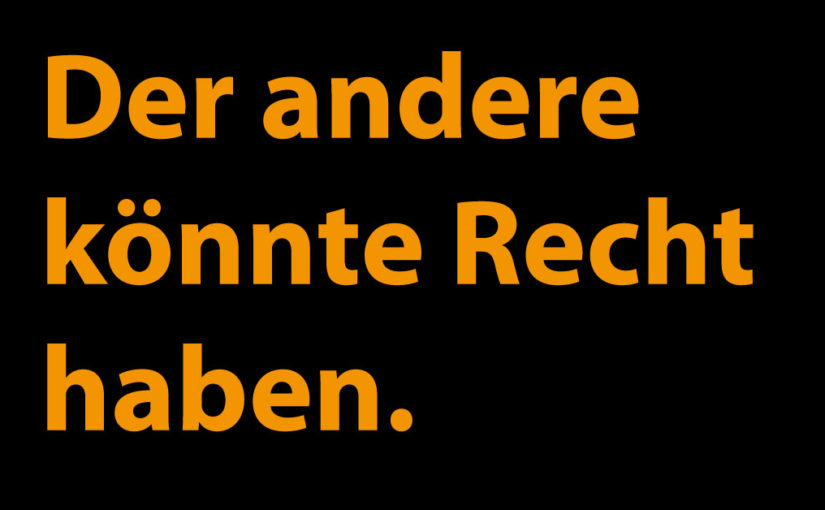Wie wird die Rechte stark? Durch Provokationen und Gejammer, sagen Per Leo, Maximilian Steinbeis und Daniel-Pascal Zorn in ihrem Buch «Mit Rechten reden». Dagegen helfe – eben, mit Rechten reden: sachlich, streitlustig, aber ohne Moralkeule.
«Sie sind da»: So titelte das deutsche Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» nach der Bundestagswahl, aus der die AfD als grosse Gewinnerin hervorgegangen war. Ja, sie sind da, die Rechten und Rechtspopulisten, angekommen in den Parlamenten, den Regierungen, der Mitte der Gesellschaft – und längst nicht nur in Deutschland. Und so schnell gehen die auch nicht wieder weg. Über die Rechten ist viel geredet worden, aber darf man auch mit den Rechten reden?
Ja, sagen der Historiker Per Leo, der Jurist Maximilian Steinbeis und der Philosoph Daniel-Pascal Zorn in ihrem klugen und anregenden Leitfaden «Mit Rechten reden». Denn der linke Reflex, die Rechten entweder systematisch zu zensieren und ihnen das Reden verbieten zu wollen oder sie von oben herab zu belehren, sei kontraproduktiv. Der Auseinandersetzung mit den Rechten dürfe man im Gegenteil nicht aus dem Weg gehen. «Demokratie ist kein Salon», ist das Autorentrio überzeugt. «Die Republik lebt vom Streit, von Rede und Gegenrede, nicht nur von Bekenntnissen und moralischer Zensur.»
Das Feindbild als Selbstbestätigung
Wer streiten will, muss seinen Gegner kennen. Wer sind also die Rechten? Leo, Steinbeis und Zorn wählen einen überraschenden Ansatz. Sie definieren die Rechten nicht über Inhalte, Programme oder Gesinnungen, sondern begreifen «rechts» als eine bestimmte Art zu reden. «Rechtes Reden ist immer polemisch. Egal, was Rechte sagen oder schreiben, sie denken ihren Gegner immer mit.» Anders gesagt: Die Rechten brauchen das linke Feindbild, es ist existenziell für ihr Selbstverständnis. «Sie müssen, um als Rechte zu existieren, gegen uns Nicht-Rechte reden.»
Auf diesem Selbstverständnis basiert auch das «rechte Sprachspiel», das Leo, Steinbeis und Zorn analysieren, also die Art, wie die Rechten mit den Nicht-Rechten reden. Schon seit Jahren. Salopp reden die Autoren vom Arschloch-Opfer-Pendelspiel. («Niemand ist ein Arschloch», stellen die Autoren übrigens klar. «Wir nennen nur dann jemanden so, wenn er sich arschlochhaft verhält, und zwar nur dann.») Dieses Sprachspiel ist ebenso einfach wie effektiv, wie die Autoren zeigen. Zuerst setzen die Rechten eine gezielte Provokation in die Welt, zum Beispiel «Der Islam passt nicht zu Deutschland» (oder, um ein Schweizer Beispiel zu nennen, das nicht im Buch vorkommt: Christoph Blochers Aussage, der Kampf gegen die SVP erinnere ihn an die Judenverfolgung). Die Reaktion erfolgt reflexartig: rassistisch, menschenverachtend, eine Verharmlosung der Naziverbrechen usw., heisst es dann. Auf diese Empörung hat der Provokateur nur gewartet, denn jetzt kann er sich als Opfer in Szene setzen: Ich wurde falsch verstanden, man darf die Wahrheit nicht mehr sagen, ohne dass gleich die «Meinungspolizei» zuschlägt, man will das Volk «mundtot» machen.
Dieses Sprachspiel bringt den Rechten nicht nur maximale mediale Aufmerksamkeit, die von den Echokammern von Facebook und Twitter noch verstärkt wird. Es dient den Rechten eben auch als permanente Selbstbestätigung ihres Weltbildes: Seht her, die böse Linke, der Staat, die «Lügenpresse» wollen uns verbieten, so zu sein, wie wir sind. Das perfide daran: Wer sich auf dieses Sprachspiel einlässt, kann nur verlieren. «Entweder wir machen sie platt, dann inszenieren sie sich als Opfer unserer Aggression. Oder wir machen sie nicht platt, dann deuten sie es als Zeichen ihrer Stärke, der Tatsache, dass sie Recht haben, und verhöhnen uns.»
Gelassen bleiben angesichts der Provokation
Der Ausweg aus dem Teufelskreis aus Beleidigen und Beleidigtsein? Das Spiel nicht mitspielen. Nicht auf die Provokation eingehen, sondern auf deren Inhalt, sagt das Autorentrio. Den anderen nicht als Feind sehen, sondern als Gegner, der Recht haben könnte. Der seine Meinung aber auch begründen muss. Denn: «Wenn Du willst, dass Deine Meinung gilt: Finde Gründe.» So lautet eine von 25 goldenen Regeln der Autoren, die sie mit dem Hinweis versehen haben «Diese Liste ersetzt nicht die Lektüre des Buchs!»
Ein Plädoyer also für einen argumentativen Wettstreit. Das klingt erst mal gut. Und nimmt auch die Nicht-Rechten in die Pflicht. Denn Moralismus ist kein Argument. Das Problem dabei: Die Rechten gehen einer inhaltlichen Auseinandersetzung häufig konsequent aus dem Weg. Hakt man nach, weichen sie aus. Im Ungefähren, im Behaupteten liegt ihre Stärke. Und treibt man sie argumentativ in die Enge, lenken sie mit einer neuen Provokation ab. Auch das zeigen Leo, Steinbeis und Zorn auf.
Einladung zum Streitgespräch
Dennoch glauben die drei Autoren, dass es möglich ist, mit den Rechten zu reden. Sie führen denn im Buch auch gleich vor, wie man mit Rechten etwa über Flüchtlinge, über das Volk, die Redefreiheit oder den Nationalsozialismus reden könnte. Und laden am Ende ihres Buches die Rechten zum Streitgespräch.
Ob das in der Praxis tatsächlich klappt? Einen Versuch wert ist es allemal. Auch wenn ich mit den literarisch-parabelhaften Kapiteln des Buches wenig anfangen konntehat sich für mich die Lektüren gelohnt. Die Analyse des «rechten Sprachspiels» hat mich überzeugt und ermuntert, das nächste Mal genauer hinzuschauen und nicht gleich in die Empörungsfalle zu tappen. Denn wer die Regeln kennt, kann auch das Spiel ändern.
Per Leo, Maximilian Steinbeis, Daniel-Pascal Zorn: Mit Rechten reden. Ein Leitfaden, Klett-Cotta, Stuttgart 2017, 183 S., ca. 22 Franken.