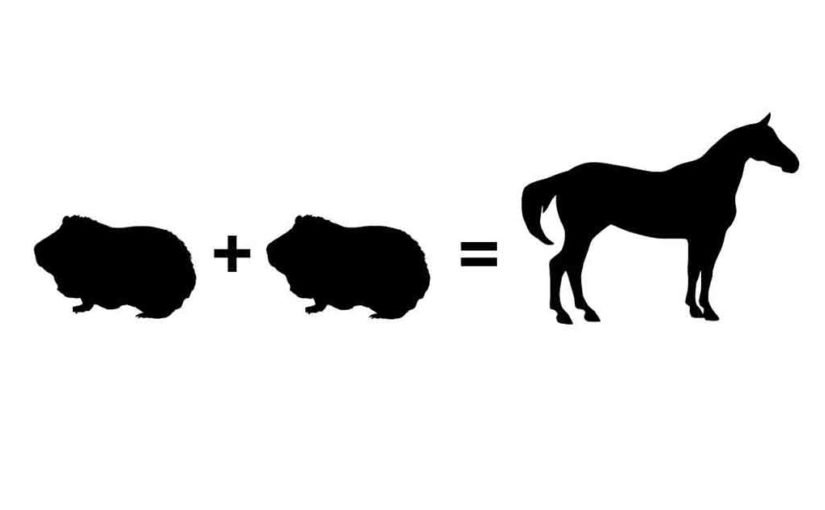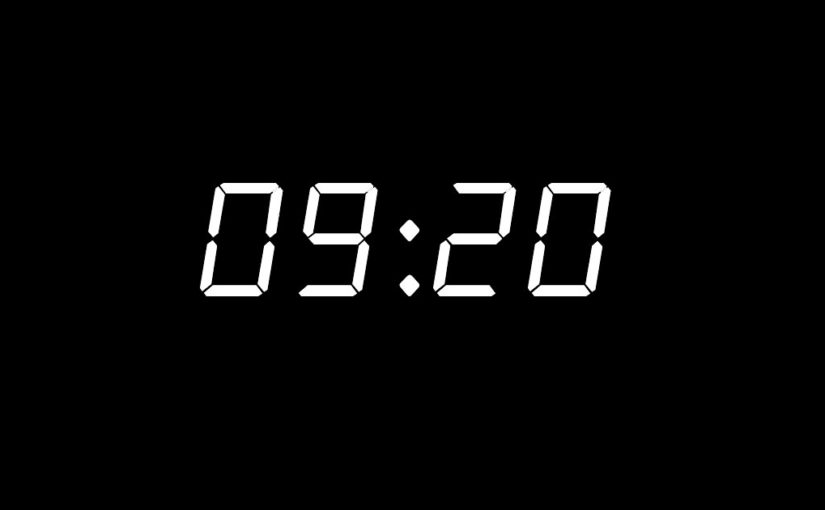«Übrigens» in den «Freiburger Nachrichten» vom 17. September 2019
Das Schönste am Herbst ist, dass der Sommer vorbei ist. Endlich. Dieser nervtötende Angeber, dieser flip-floppende Grosskotz, der es wie die Sonnenuhr macht: Er hält sogar seinen Schatten für das Mass aller Dinge. Der längste Tag, die kürzeste Nacht (aber tropisch!), Rekordtemperaturen – drunter macht es der Sommer nicht. Er ist eben der Trump unter den Jahreszeiten: Völlig verpeilt in seiner Selbstüberschätzung, spaltet er die Nation in jene, die ihn heiss lieben, und jene, die ihn am liebsten loswerden würden (#ImpeachSummer).
Den Herbst hingegen lob ich mir. Er ist wie die CVP: Wankelmütig (fröstelkalt am Morgen, am Nachmittag reichts noch fast einmal für die Badi), auf Ausgleich bedacht (Tagundnachtgleiche) und tendenziell auf dem absteigenden Ast. Im Gegensatz zum Sommer muss sich der Herbst nicht in Pose werfen, er ist kein Lautsprecher, kein Blender, kein greller Typ, nein, der Herbst hat die ganz grosse Farbstiftkiste von Caran d’Ache in die welken Hände gelegt bekommen. Keiner kann mehr Zwischentöne und Nuancen als er.
Und um einiges leiser als der Sommer ist er auch. Für das Dröhnen der Laubbläser kann er ja nichts. Ihren raschelnden Striptease vollführen die Bäume nicht für uns, sondern nur für sich selbst; deshalb erröten sie ja auch, wenn man ihnen beim Entblättern zuschaut. Bald schon stellt man die Heizung wieder an, mit schlechtem Gewissen, weil man immer noch mit Öl heizt (der nächste Sommer wird noch heisser werden). Und man schaut den Schwalben bei ihrer Flugakrobatik zu (#flugcharme) und fühlt sich selber leicht und beschwingt dabei, Sauser sei Dank.
Ja, die Natur fährt noch einmal das ganz grosse Buffet auf, aber aus der Überfülle tötelet uns die allgemeine und eigene Vergänglichkeit entgegen. Deshalb auch die Bénichon, diese kollektive Völlerei wieder jede Vernunft und Ernährungsempfehlung: sich noch einmal den Bauch vollschlagen, wer weiss, ob man nächstes Jahr noch mit am Tisch sitzt.
Alles vergeht, daran erinnert uns der Herbst. Und den Garaus gemacht hat er zum Glück auch den Sommerferien der Kinder, diesen siebeneinhalb Wochen, die zäh dahinflossen wie Asphalt in der glühenden Sommerhitze. Siebeneinhalb unendlich lange Wochen, bei denen am Schluss die Nerven mancher Eltern und Kinder so blank lagen wie die Flanken der einst vergletscherten Berge.
Nun sind die Kinder wieder aus dem Haus und reifen ihrer schulischen Vollendung entgegen. Dem Herbst sei Dank. Dafür verzeih ich ihm alles andere: den Nieselregen, die Nebeltage und den unvermeidlichen Wurm in den heissen Marroni.