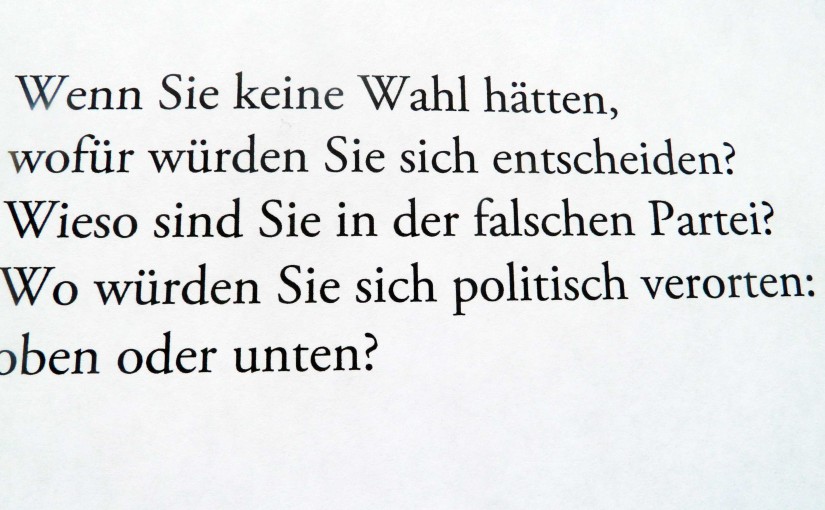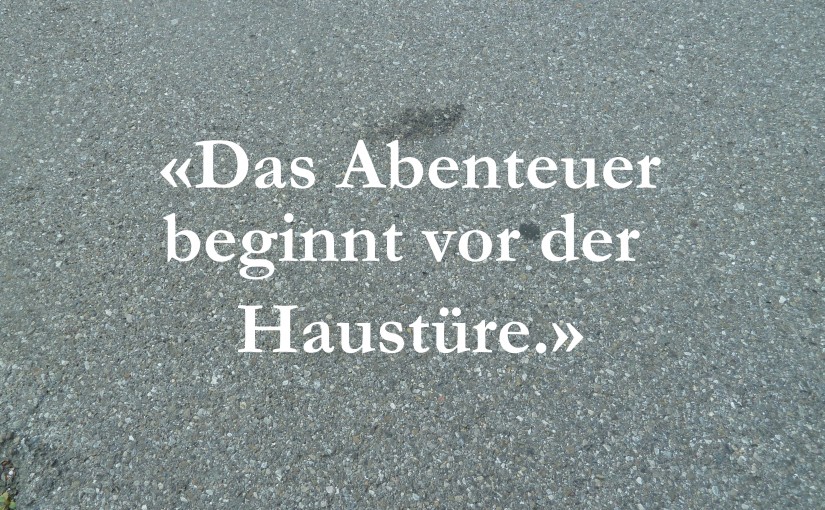«Übrigens» in den Freiburger Nachrichten vom 3. September 2015
Aus welchem Grund soll ich Sie wählen? Aus welchen drei Gründen sollte ich Sie besser nicht wählen? Wen wählen Sie? Würden Sie mich wählen? Wenn Sie keine Wahl hätten, wofür würden Sie sich entscheiden?
Bier oder Cüpli? Wieso antworten 90 Prozent der Befragten mit «Bier», obwohl sie lieber Rotwein mögen? Bratwurst oder Bratwurst? Was hat diese Frage mit Politik zu tun?
Ab wann ist ein Lohn unanständig hoch? Wie viel verdienen Sie? Geben Sie immer ausweichende Antworten? Sind Sie bestechlich? Wie gut muss ein Verwaltungsratsposten entlöhnt sein, damit Sie das Mandat annehmen? Geben Sie immer ausweichende Antworten?
Was wollten Sie als Kind werden? Bereuen Sie, stattdessen Politiker geworden zu sein? Was wollen Sie nach Ihrer Pension anstellen? Was stellen Sie an, damit Sie noch eine Pension erhalten?
Wo liegt Europa? Und die Schweiz? Und wo stehen Sie?
Wie würden Sie sich politisch verorten: oben oder unten?
Aus welchen Gründen würden Sie aus der Schweiz flüchten? Und wohin? Würden Sie Ihr Leben dafür riskieren?
Was war Ihr letzter Post auf Facebook? Wie viele Likes haben Sie dafür gekriegt? Haben Sie nichts Besseres zu tun?
Wie oft kommt das Wort Gott in der Nationalhymne vor? Möchten Sie etwas dazu sagen? Oder singen?
Wieso lieben Politiker eigentlich die Angstmache und die Schwarzmalerei? Wieso gibt es keine Partei, die uns Glück verspricht? Was ist Glück (und zitieren Sie nicht Paulo Coelho)?
Worüber haben Sie das letzte Mal geweint? Sagen Sie immer die Wahrheit–oder nur, wenn es nicht wehtut?
Gefallen Sie sich auf Ihrem Wahlplakat? Wie viele davon haben Sie drucken lassen? Ist ein Gesicht wichtiger als Inhalte? Wieso ist dann Ihr Slogan so nichtssagend?
Welches Argument können Sie nicht mehr hören? Ihr Lieblingsargument in politischen Debatten? Stört es Sie, dass die anderen das nicht mehr hören können?
Wer steht auf dem Listenplatz hinter Ihnen? Was kann sie oder er besser als Sie? Und wieso haben Sie dann denn besseren Listenplatz?
Wenn Sie am 18. Oktober nicht gewählt werden, wie oft treten Sie erneut an? Soll man Sie dafür bewundern oder bemitleiden? Wenn Sie nicht gewählt werden, kandidieren Sie dann für den Gemeinderat? Wieso ist Ihnen dieser Gedanke nicht selber gekommen?
Wie viel kostet ein Liter Milch? Wie viel kostet Ihr Auto? Wie viel kostet ein Ticket nach Bern? Wieso wollen Sie eigentlich nach Bern, gefällt es Ihnen hier nicht mehr?
Darf ich Ihnen noch eine letzte Frage stellen? Wieso sind Sie in der falschen Partei?