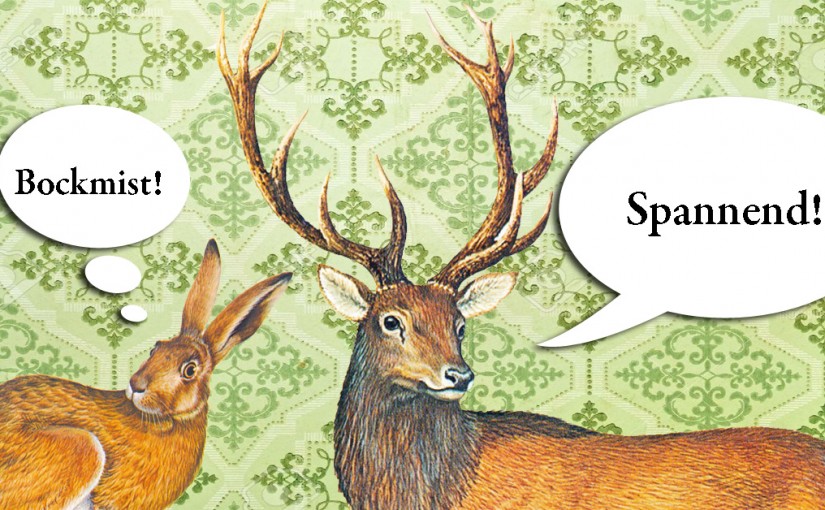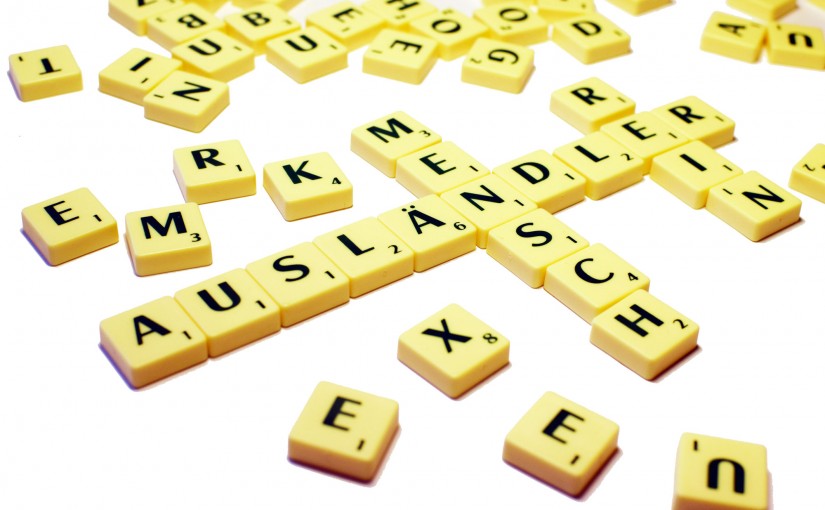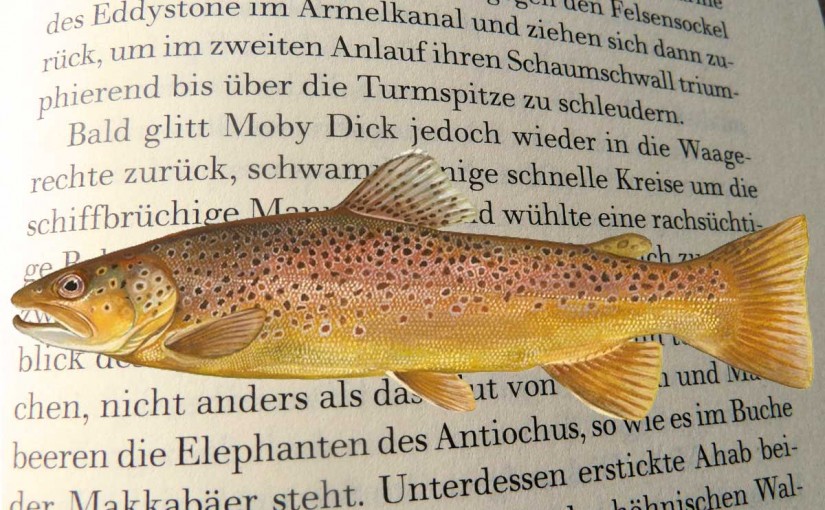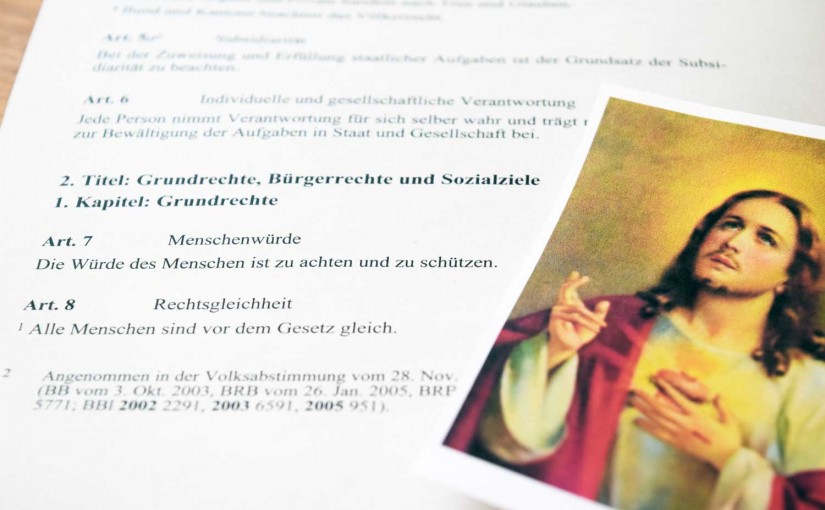«Übrigens» in den Freiburger Nachrichten vom 5. April 2016
«Vielleicht», sagt mein Freund und greift in die Chips-Schale, «vielleicht wäre es doch langsam an der Zeit, mit Sport anzufangen. So mit 40.»
«Wie wärs mit Joggen? Das machen jetzt alle», sage ich und schenke Wein nach.
«Auf keinen Fall. Total schlimm für die Gelenke. Und wenn du es regelmässig machst, wirst du süchtig nach den Endorphinen. Und irgendwann bist du eines dieser freudlosen Marathon-Männchen mit Streichholzbeinchen, die behaupten, 42 Kilometer zu seckeln sei ein Ausgleich zu ihrer 70-Stunden-Woche.»
«Dann halt Nordic Walking», schlage ich vor.
«Das ist doch nur für Frauen», sagt er und nimmt einen kräftigen Schluck Wein. «Wie Joggen; einfach so langsam, dass man dazu noch plaudern kann. Ein mobiles Kaffeekränzchen–mit Stöcken.»
«Velofahren?», probiere ich es und hole die Wasabi-Nüsschen, weil die Chips alle sind.
«Sich die Pässe hochquälen, eingenäht in einen neongelben Kunstdarm? Und sich von der Rentnergruppe demütigen lassen, die freundlich grüssend mit dem E-Bike vorüberzieht? Ganz habe ich meine Selbstachtung noch nicht verloren.»
«Ich hab früher in der Schule Fussball gespielt; so plauschmässig wär das vielleicht was für dich.»
«Kennst du die Suva-Statistik nicht? Grümpelturniere sind das Schlachtfeld des Ü40-Mannes, wo Selbstüberschätzung und mangelnde Fitness ins blutige Fiasko führen. Ich sag nur ‹FC Blutgrätsche› gegen die ‹Gerissenen Bänder›.»
«Dann eben Aquafit, da zerrst du dir sicher nichts.»
«Das ist so was von 60 Plus. Mache ich nur, wenn mich der Arzt dazu zwingt. Und auch dann nur mit dem Kopf unter Wasser, bis ich das Bewusstsein verliere und sie mich aus dem Becken zerren und aus dem Kurs werfen müssen.»
«Golf?» – «Zu teuer.» – «Minigolf?» – «Zu billig. Kein Prestige.»–«Dann bleibt aber nicht viel übrig», sage ich.
«Eigentlich nur eines. Seinen körperlichen Zerfall nicht krampfhaft aufhalten zu wollen – sondern hinzunehmen.»
«Ihn vielleicht sogar zu beschleunigen?», schlage ich vor und fülle die Gläser nach. «Unbedingt», stimmt er zu. «Und ihn zelebrieren. Das Nichtstun als Protest gegen den allgegenwärtigen Fitness-Terror.»
«Der Faulenzer als heiliger Ketzer wider das ungesunde Dogma der permanenten Körper-Optimierung.»
«Mein Bauch gehört mir, nicht dem Fitnessstudio.»
«Leben ist Sport genug.»
«Und euren Grünkohl-Smoothie könnt ihr euch sonst wo hinstecken.»
«Das könnte man vielleicht sogar wettkampfmässig betreiben», kommt es mir spontan in den Sinn. «Dann müssen wir aber unbedingt härter trainieren», sagt mein Freund. «Hast du noch eine Flasche?»
- Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Facebook
- Klicke, um auf X zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) X
- Klick, um auf LinkedIn zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) LinkedIn
- Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) WhatsApp
- Klicken, um einem Freund einen Link per E-Mail zu senden (Wird in neuem Fenster geöffnet) E-Mail