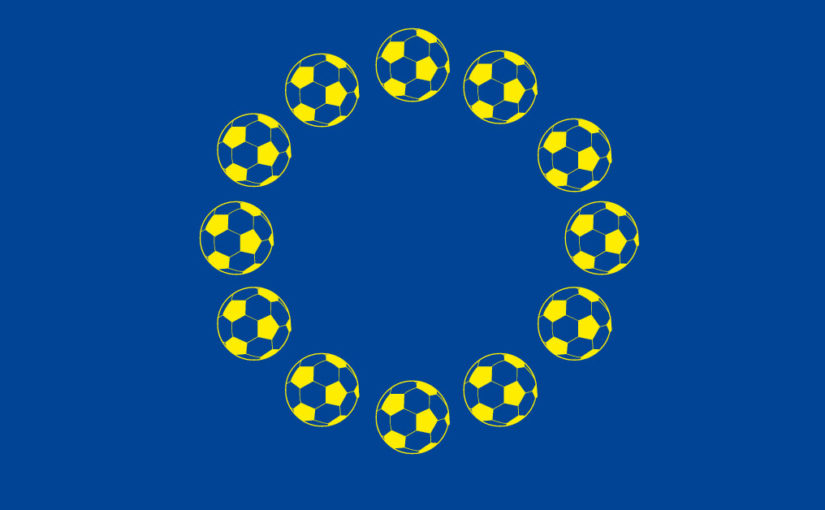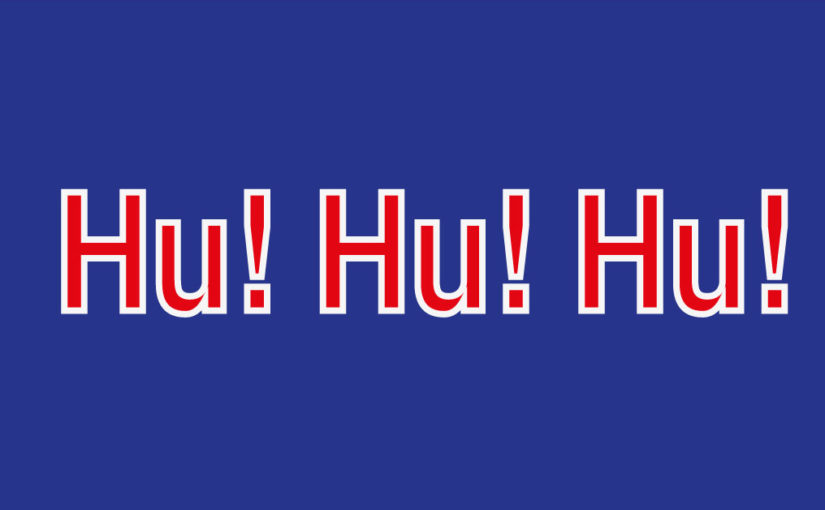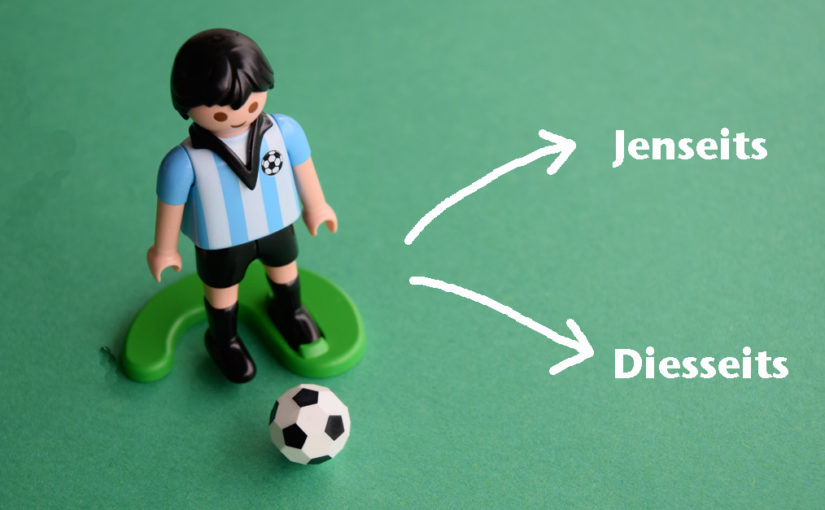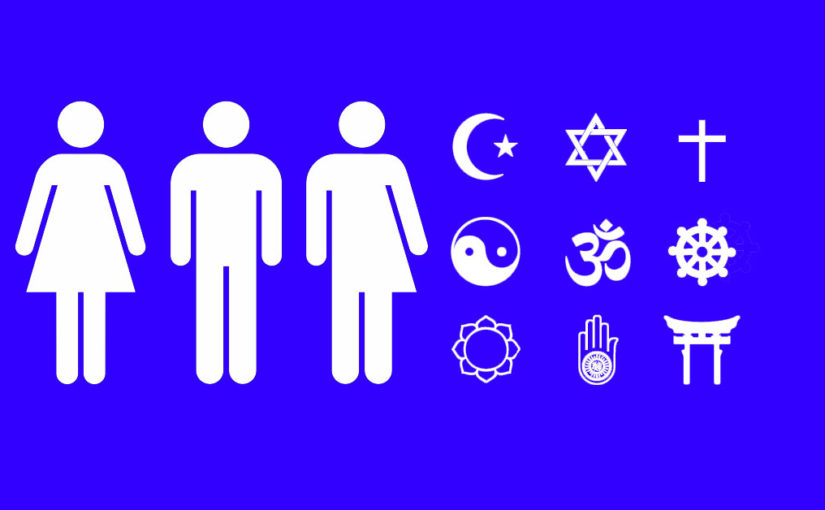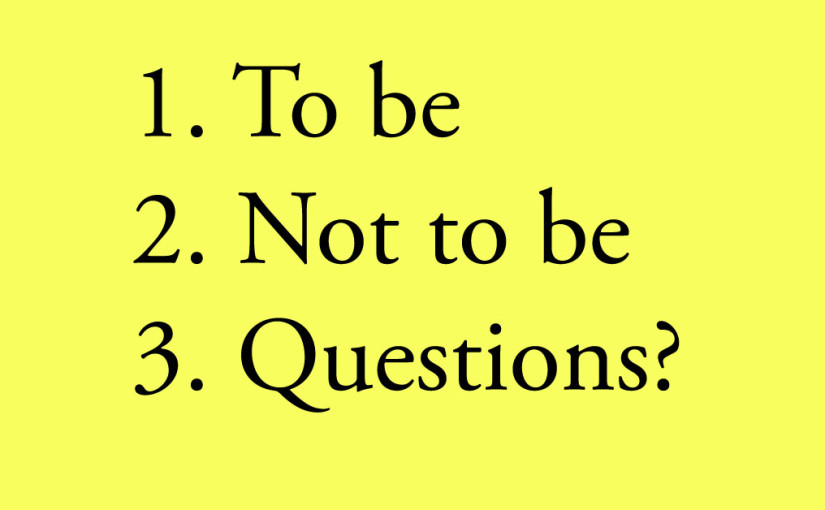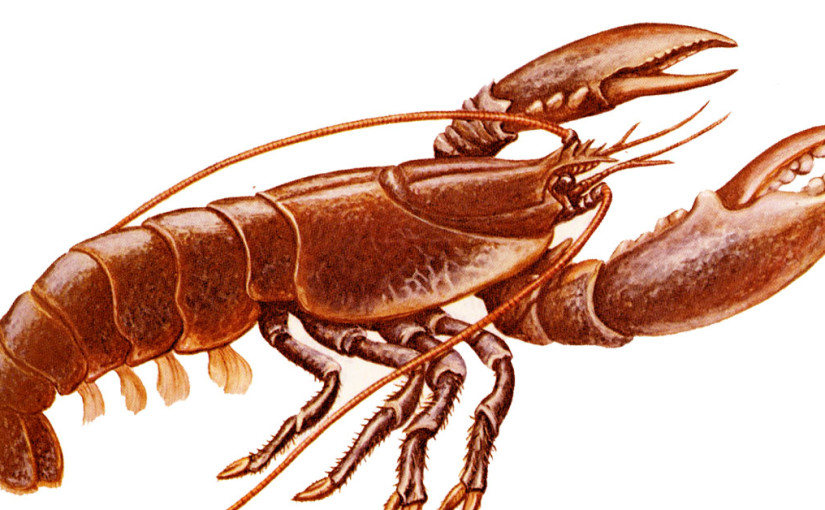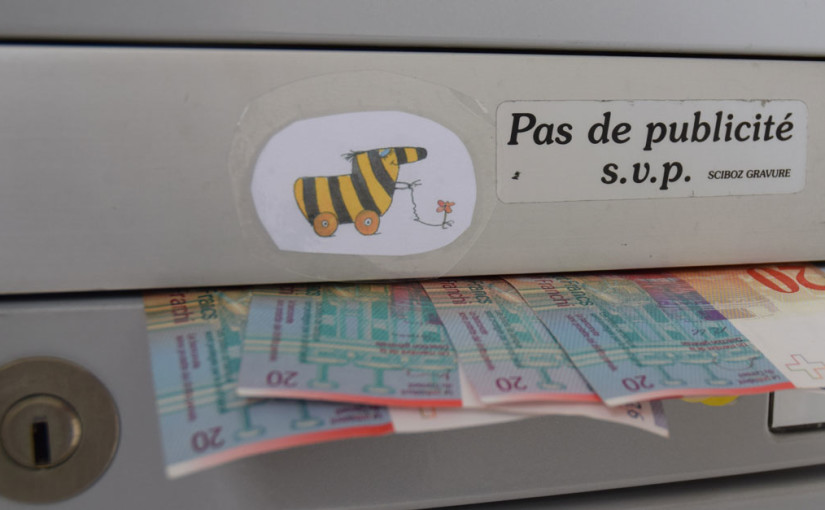«Übrigens» in den Freiburger Nachrichten vom 16. August 2016
Es passierte auf den letzten Metern. Sturzenegger lag wie erwartet unangefochten in Führung. Noch ein paar Hüpfer und der Olympiasieg war ihm sicher. Und dann dieser verfluchte Schnürsenkel. «Mach doch einen Doppelknoten, Gopfertellisiech», hatte ihm sein Trainer schon tausendmal gesagt. Aber Sturzenegger war abergläubisch. Doppelknoten brachten Unglück. Und stets hatte sein Knoten gehalten. Aber ausgerechnet heute löste sich der Schnürsenkel.
Sturzenegger rutschte aus dem Schuh und verlor das Gleichgewicht. Bevor er mit seinem Gesicht hart auf der Bahn aufschlug, zog sein Sportlerleben im Zeitraffer an ihm vorbei: Die bescheidenen Anfänge in der Jugi Hinterhüpfikon. Der Dorfmüller, der ihn mit dem nötigen Sportgerät versorgte. Der Kampf um Anerkennung für seine Sportart, die von vielen als Kinderkram belächelt wurde. Das erniedrigende Klinkenputzen bei möglichen Sponsoren (zum Glück hatte ihm der Müller die Treue gehalten).
Aber dann, vor einem Jahr, endlich der lang ersehnte Ritterschlag: Das Olympische Komitee hatte Sackhüpfen zur olympischen Sportart erklärt–auch dank Sturzeneggers Überzeugungsarbeit als Präsident der International Sack Race Federation. Jetzt würde sie niemand mehr ungestraft als Sackflöhe verunglimpfen. «Wenn Schiessen olympisch ist, dann muss es Sackhüpfen auch werden», hatte er immer gesagt. Die Schützen brauchten ja nur ein Auge zuzukneifen und den Finger krumm zu machen. Sackhüpfen aber, das war Kraft, Ausdauer, Geschicklichkeit–zudem brauchte es mentale Stärke, um in einen Sack zu schlüpfen und Bewegungen zu vollführen, die sich einem Laienpublikum nicht gerade als graziös erschlossen.
So war Sturzenegger mit dem Ziel an die Olympiade gereist, Geschichte zu schreiben. Er wollte als erster Olympiasieger im Sackhüpfen in die Annalen eingehen und danach zurücktreten. Die Knie.
Aber nun lag er am Boden. Im Mund schmeckte er Blut. Durch tränenverschleierte Augen musste er zusehen, wie seine Konkurrenten an ihm vorüberzogen. Baggins, Beutelschneider, Sacchelini, Sackov. Sturzenegger beendete das Rennen nicht. Teilnahmslos liess er sich von seinem Trainer zum Arzt bringen, der die klaffende Platzwunde auf seiner Stirn mit 13 Stichen nähte. Zugedröhnt sass er auf dem Stuhl, als der Zahnarzt seine zwei ausgeschlagenen Schaufelzähne ersetzte.
Als Sturzenegger im Olympiadorf traurig sein zerschundenes Gesicht im Spiegel studierte, musste er plötzlich grinsen und dann lauthals herauslachen. Der Zahnarzt hatte ihm zwei blitzende Goldzähne eingesetzt. Sturzenegger würde trotz allem olympisches Gold nach Hause bringen. Doppel-Gold sogar.