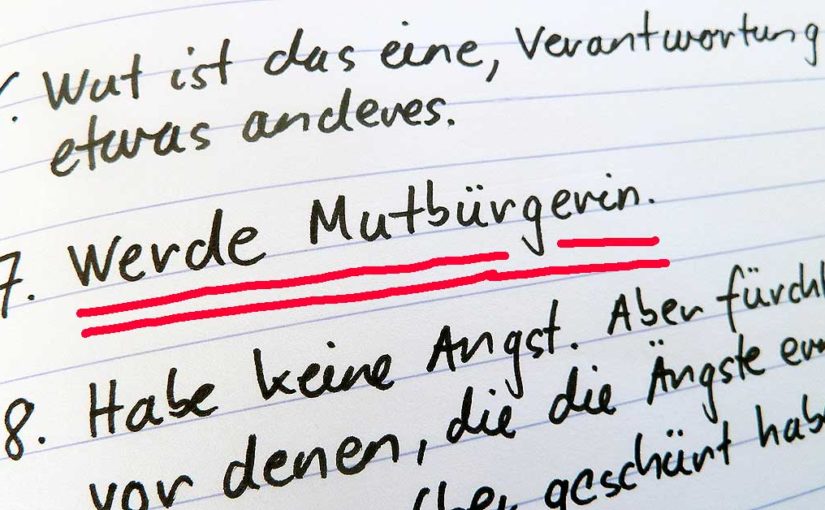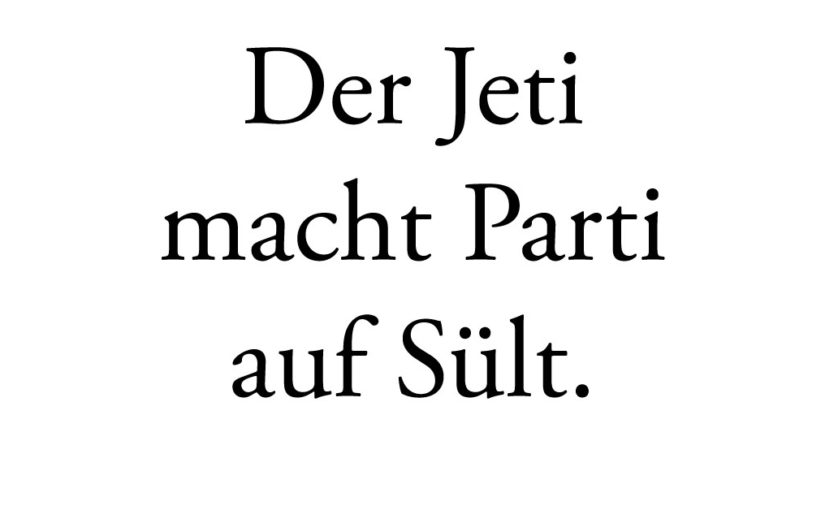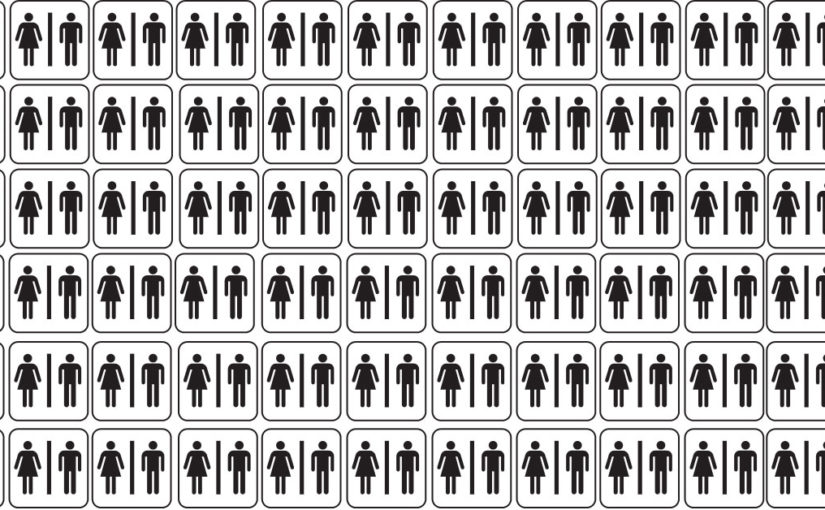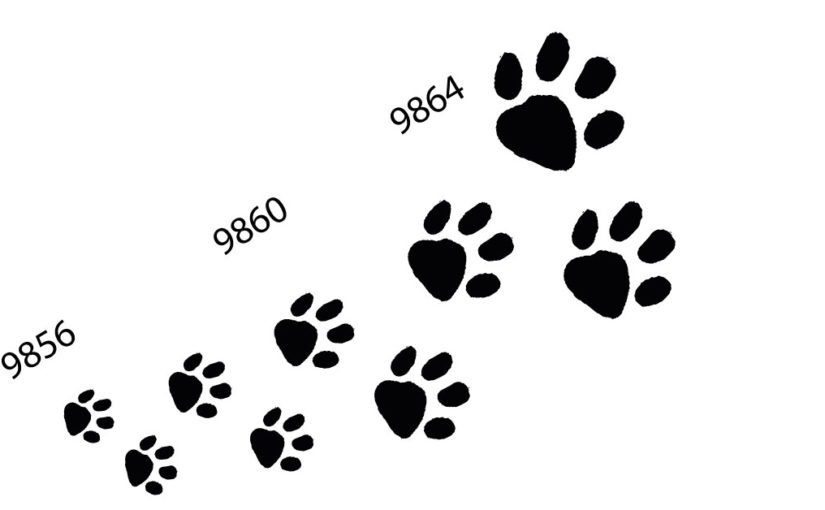«Übrigens» in den Freiburger Nachrichten vom 9. Dezember 2016
«Ich möchte meiner Frau gerne nichts zu Weihnachten schenken. Können Sie mir da etwas Schönes empfehlen?» Einen kurzen Moment schaut mich die Verkäuferin entgeistert dann, dann schleicht sich ein verschwörerisches Lächeln in ihr Gesicht. «Ah, Sie meinen ein Negligé. Ein Hauch von Nichts. Macht nicht nur beim ersten Auspacken Freude», sagt sie und zwinkert mir zu. «Nein, nein», wehre ich verlegen ab. «Sie verstehen mich falsch. Meine Frau hat sich ausdrücklich nichts gewünscht.»
«Sie hat ja recht», sagt die Verkäuferin, «der ganze Geschenkerummel ist ja wirklich übertrieben.» Ich nicke. «Aber über eine Kleinigkeit freut sich Ihre Frau bestimmt», versucht sie es und streckt mir ein Parfümflakon aus vergoldetem Kristallglas unter die Nase. «Wie wäre es damit?» Ich schiele aufs Preisschild. «Für eine Kleinigkeit ist das aber ziemlich teuer.» «Am Fest der Liebe schaut man doch nicht auf den Preis», sagt sie.
«Das ist es», sage ich. «Liebe. Aber nicht diese McKinsey-Liebe, die exakt Buch darüber führt, was sie investiert und was sie zurückbekommt. Sondern eine Liebe, die sich verschwenderisch verschenkt, als gäbe es kein Morgen. Und Zeit könnte ich schenken. Haben Sie Zeit?» Nein, sagt die Verkäuferin, im Advent habe sie eigentlich nie Zeit, und schaut auf die Kunden, die ungeduldig hinter mir warten. «Schade», entgegne ich. «Zeit sollte man sich für den anderen nehmen, gerade wenn man selbst am wenigsten davon hat. Zärtlichkeit wäre auch gut, nicht nur am Freitagabend, sondern in kleinen alltäglichen Gesten. Haben Sie da etwas, vielleicht in Kaschmirqualität?» Die Verkäuferin schüttelt den Kopf.
Ich komme in Fahrt: «Starke Schultern könnte ich ihr schenken, weiche Knie, helfende Hände, offene Ohren und umarmende Arme, wenn sie die Nase voll hat – und ein Walzer tanzendes Herz, wenn ihres überquillt vor Freude. Und was sie von meinen Körperteilen halt sonst noch so gebrauchen kann.»
Die Verkäuferin schaut sich nach dem Filialleiter um.
«Respektvolle Widerworte und unerschütterliche Zustimmung. Unpassende Bemerkungen im passenden Moment. Schweigen, wenn Reden nicht hilft. Sand ins Getriebe der Alltagsmaschinerie und Öl in die Scharniere der ungenutzten Möglichkeiten, damit ihr Quietschen einen nicht mehr erschreckt. Feuerwerke der Freude und Lust, wenn der Alltagsfrust wie ein übellauniges Nashorn auf der Seele hockt. Und Liebe natürlich. Ganz viel davon.»
«Das ist aber ganz schön viel», sagt die Verkäuferin. «Sie haben recht», sage ich, «zu viel für Weihnachten. Aber verteilt aufs Jahr?» «Schon», sagt sie, «aber das alles kann man ja gar nicht kaufen.» «Kaufen nicht, aber schenken.»