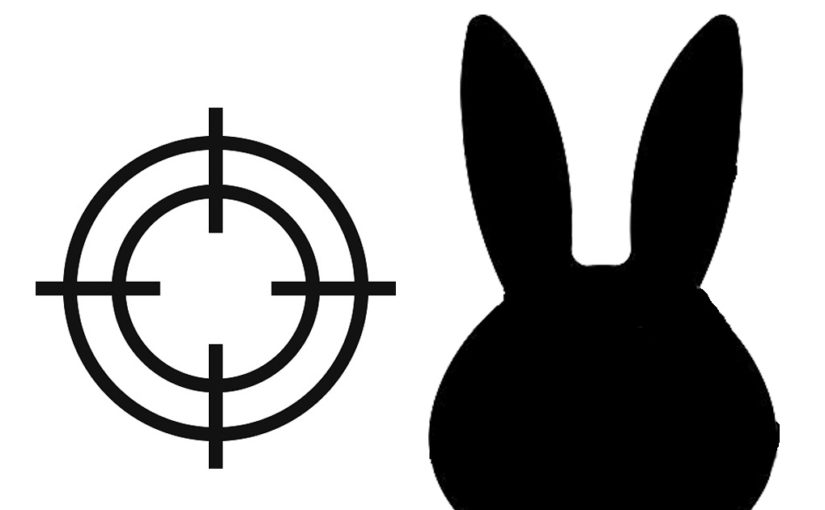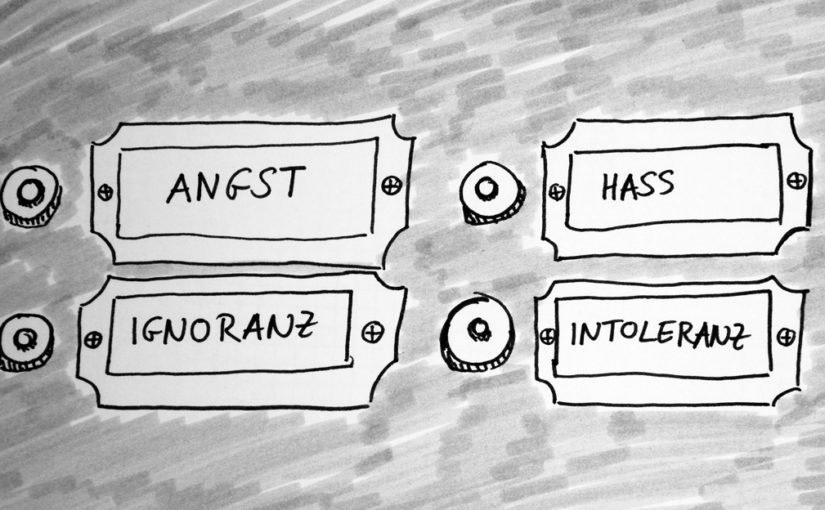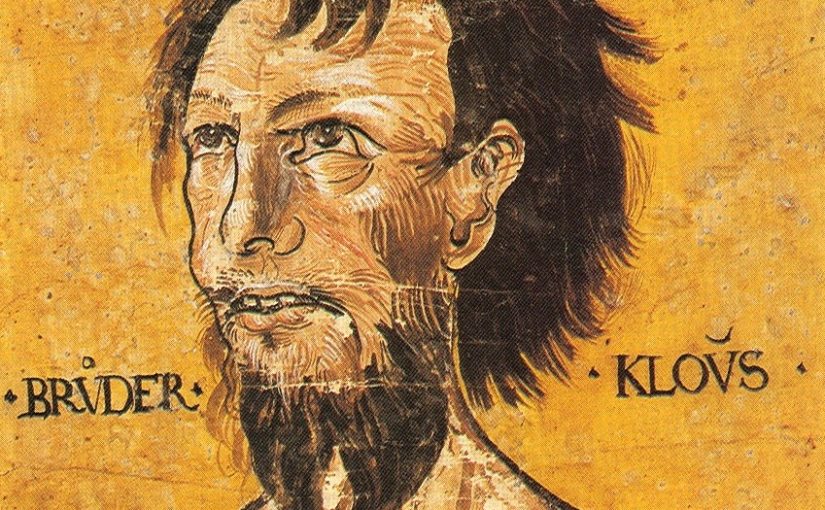«Übrigens» in den «Freiburger Nachrichten» vom 21. April 2017
Mein Duschmittel kann mehr Latein als ich. Lesen Sie mal die Inhaltsstoffe durch. So viel Vergil, nur damit wir nicht stinken. Und am Schluss geht die ganze klassische Chose den Bach runter. Wahnsinn. Dubiose Chemikalien, viel Plastikmüll: Vor kurzem sagte ich deshalb meinem Duschgel Adieu und kaufte mir stattdessen eine Duschseife. «Aber bitte ohne Palmöl», sagte ich in der Apotheke, denn «Sodium Palmate pfui est», wie der Lateiner zu sagen pflegt. Die Verkäuferin reichte mir einen unansehnlichen ockerfarbenen Mocken mit arabischen Schriftzeichen drauf. 78 Prozent Olivenöl, 12 Prozent Lorbeeröl, Natronlauge. Simpler geht Seife nicht.
Erst zu Hause las ich, was auf der Packung stand: «Savon d’Alep. Fabriqué en Syrie». Und auf einmal war der Krieg ganz nah. Hautnah.
Ich sah die Fernsehbilder des umkämpften Aleppos vor mir: Helfer, die tote Kinder aus den Trümmern zerren; Spitäler und Wohnviertel, auf die Assad hatte Fassbomben werfen lassen.
Sechs Jahre geht das Morden in Syrien jetzt schon. 400 000 Menschen getötet, Millionen auf der Flucht. Wir sehen und lesen es täglich. Und wir nehmen es zur Kenntnis. Zucken mit den Schultern. «Schlimm, aber was will man machen?» Blättern um, zappen weiter.
Jeden Morgen seife ich mich mit der Aleppo-Seife ein und frage mich, was wohl aus dem Seifensieder geworden ist, der sie nach jahrhundertealtem Rezept gekocht hat. Ob er in der zerbombten Stadt ums Leben gekommen ist? Sitzt er in einem von Assads Folterknästen? Oder war vielleicht er derjenige, der die Giftgaskanister ins Kampfflugzeug geladen hatte, das dann Kurs nahm auf Chan Scheichun?
Ich stehe unter der Dusche und spüre Wut und Hilflosigkeit angesichts der Gräuel in Syrien. Ich habe ja keine Marschflugkörper, die ich abfeuern kann. Und einen syrischen Flüchtling aufnehmen? Das liegt leider auch nicht drin. Wir haben ja auch nur eine Dusche.
Jeden Morgen wasche ich mich mit Aleppo-Seife, schön geschmeidig macht sie die Haut, aber ich werde das Gefühl nicht los, schuldig zu sein. Wenn wir von dem Leiden wissen und nichts dagegen tun, oder zu wenig (und wie viel ist genug?) – machen wir uns dann nicht mitschuldig wegen unterlassener Hilfeleistung?
Wie reagieren auf das Leid? Spenden? Sich auf Facebook per Mausklick solidarisieren? Mit dem Papst beten? Mit warmen Decken am Strand in Italien auf die durchnässten Bootsflüchtlinge warten? Ich weiss es nicht. Wie stellt man es an, nicht abzustumpfen? Und wie hilft man so, dass die Hilfe wirklich hilft – und nicht nur das Gewissen beruhigt?
Ich wünschte, ich hätte eine Antwort. Aber ich bin ja schon beim Duschen mit meinem Latein am Ende.
Übrigens, dieser Text erscheint auch im Blog von «aufbruch», der unabhängigen Zeitschrift für Religion und Gesellschaft.