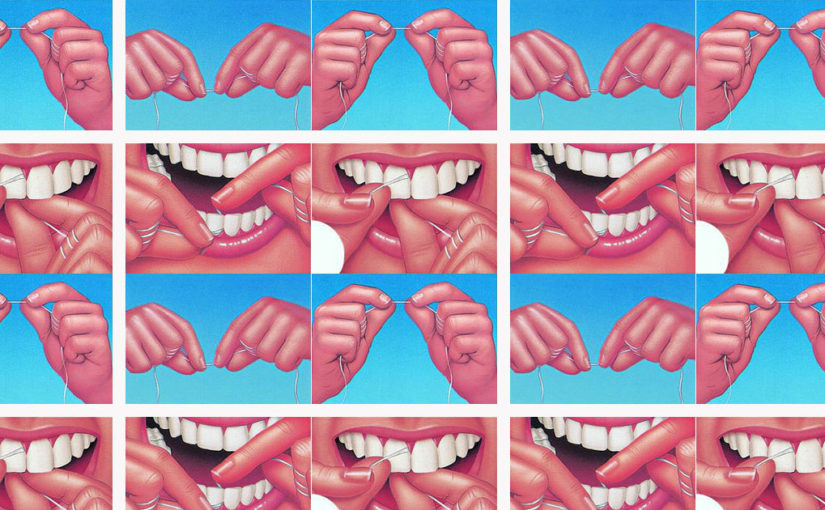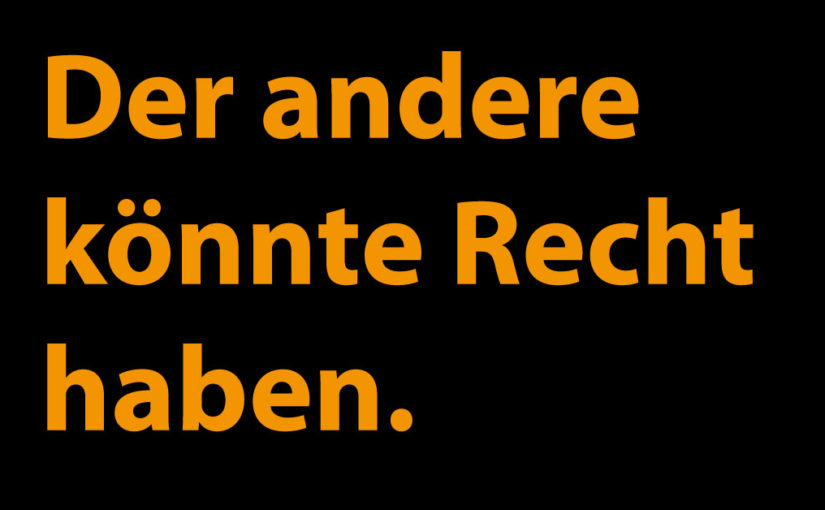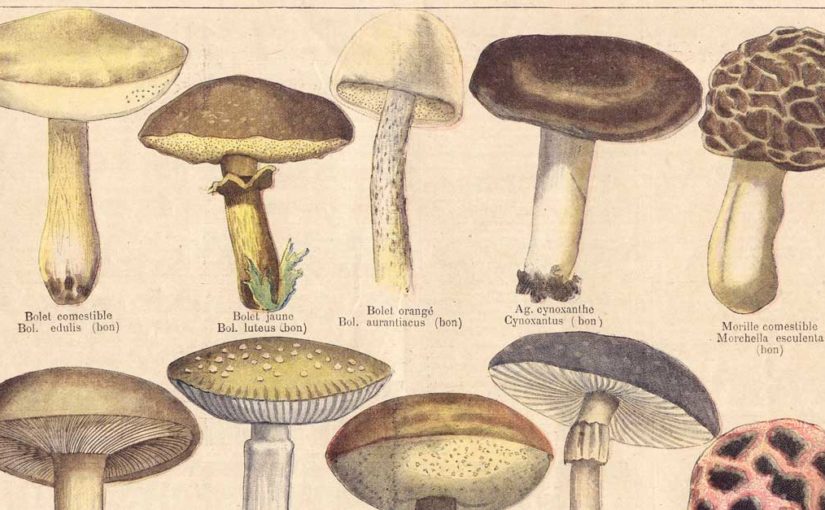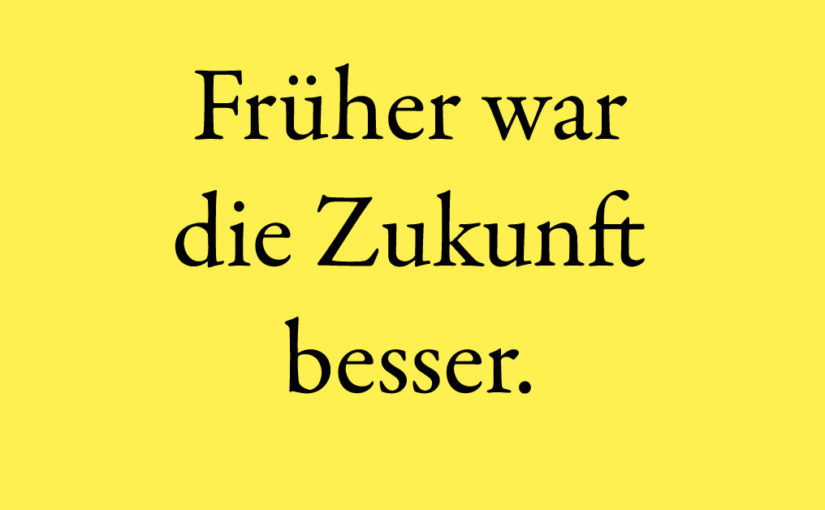«Übrigens» in den «Freiburger Nachrichten» vom 29. November 2017
Langsam komme ich in ein Alter, wo ich jeden dritten Satz mit «Früher war …» beginne. Das nervt mich selber, aber heute muss es sein. Früher war vieles einfacher. Zum Beispiel das mit dem Adventskalender. Es gab zwei Sorten: die mit Bildli und die mit Schoggi. Wenn man grosses Glück, also wirklich ganz grosses Glück hatte, bekam man beide geschenkt: den Bildlikalender von den Eltern und den Schoggikalender vom Grosi. Und man liebte beide – die Bildli und die Schoggi, die Eltern und das Grosi. Das Grosi aber ein bisschen mehr.
Heute bereitet der Kauf eines Adventskalenders grössere Qualen als früher die Brunsli von Tante Frieda. Denn es gibt einfach alles: Adventskalender mit Bier, Whiskey, Rum, mit allem kann man sich durch den Advent saufen – und die Brunsli erträglich trinken und Tante Frieda gleich mit. Es gibt den Handwerker-Kalender für Ihn (Jesus hätte bestimmt auch Freude an einem Winkelschraubendreher gehabt), den Beauty-Kalender für Sie (damit nur die Mandarindli schrumpelige Haut kriegen) und den Sexspielzeug-Kalender für beide («O o o ooohhh oooohhh du fröhliche»).
Es gibt den Krimi-Kalender und den Müesli-Kalender, einen für Veganer und einen für Wurstliebhaber. Denn, hey: Weihnachten ist für alle da – solange die Kasse stimmt. Heftig umworben werden auch die Kleinen. Die müssen sich entscheiden, ob sie sich das Warten auf Weihnachten lieber mit Lego oder Playmobil verkürzen wollen. Jedes Türchen ein Figürchen. Und alles immer schön gendermässig gepimpt: Ponyhof für die Mädchen, Star Wars für die Buben.
Wenn Ihnen das auch auf den Weihnachtskeks geht, dann habe ich einen Vorschlag. Wie wäre es, wenn wir uns selbst zum Adventskalender machen würden? Wie das geht? Einfach jeden Tag bis Weihnachten ganz bewusst ein Türchen aufmachen zur wüsten, wilden, wunderbaren Welt jenseits unserer Wohlfühlblase. Unsere Haustür öffnen und jene in die warme Stube bitten, die draussen stehen und frieren. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Unsere Augen öffnen für das, was schiefläuft in der Welt. Unsere Herzen weit auftun für das Leid und die Freude der anderen. Und unsere Hirne durchlüften lassen von neuen, fremden, irritierenden Ideen.
Wie das herauskommt? Keine Ahnung. Vielleicht werden aus Fremden Freunde. Vielleicht essen sie auch nur unsere Schoggi auf und bringen Dreck in die Stube. Und vielleicht vertreiben auch 24 Schnäpse das Bauchweh nicht, das dabei aufkommt.
Uns allen ginge dabei aber sicher das eine oder andere Lichtlein auf.
Und Weihnachten würde umso heller strahlen.