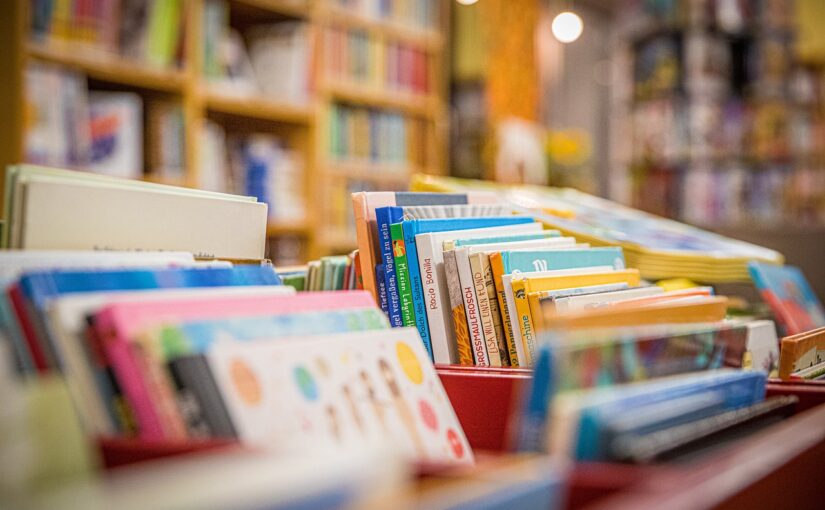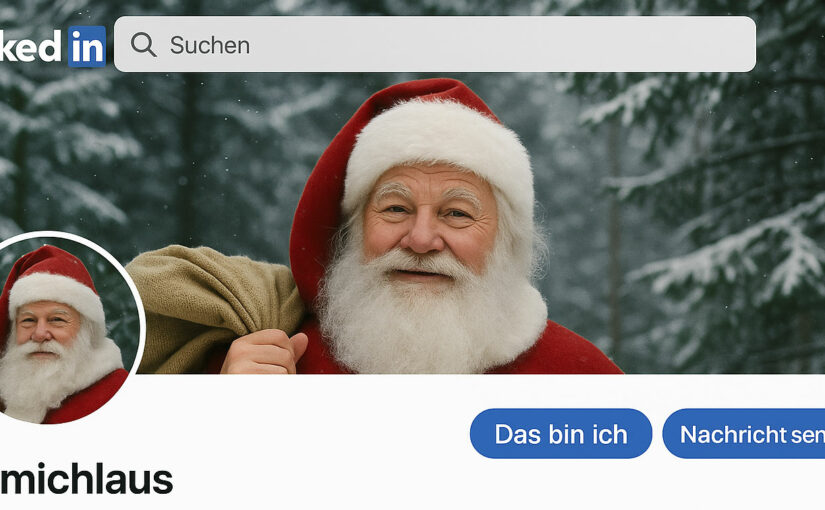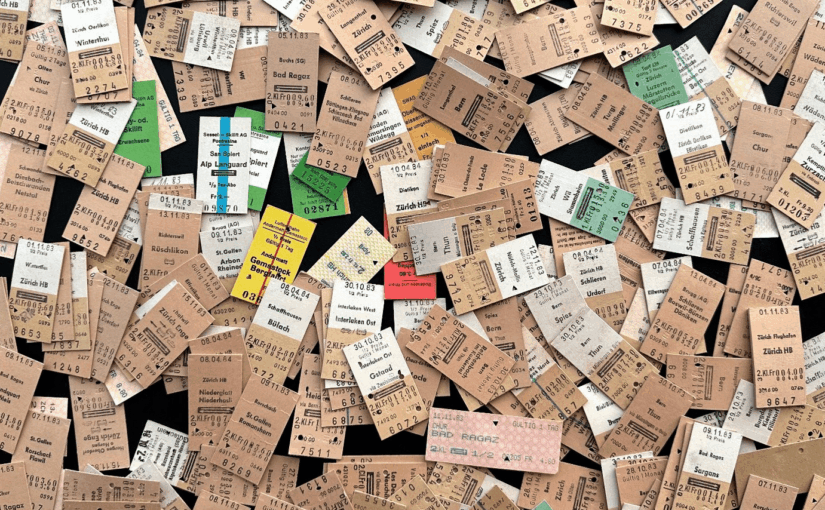«Übrigens» in den «Freiburger Nachrichten» vom 3. Februar 2026
Wir leben im Zeitalter der Schubladen. Jeder steckt jeden irgendwo hinein: Knoblauchhasserin, alter weisser Mann, Umweltsau, Woke-Taliban. Etikett drauf, Schublade zu – Feuer frei. Als könnte man Menschen auf ein Schlagwort reduzieren, wo wir alle doch ganze Wörterbücher sind, vielseitig, überraschend, widersprüchlich.
Ich zum Beispiel (als handelsübliches Exemplar) bin, in alphabetischer Reihenfolge und ohne Anspruch auf Vollzähligkeit: Allgemeinversicherter AGB-Akzeptierer und Aquarell-Punk (Kunst kommt von Spass, nicht von Können), Bibliotheksbesucher und Berliner-Vernascher (das Gebäck, nicht die Hauptstädter), Brettspielspieler und Bauch-Ansatz-mit-weitem-Hemd-Kaschierer. Ich bin Champion im Chromstahlglanz, Dudenversteher und Dad-Joke-Instanz (sagen meine Kinder, nicht ich).
Ex-Briefmarkensammler und aktiver ELF (Erwachsener Lego-Fan), Fussgänger mit Führerschein, Fussball-Ignorant und Grümpelturnier-Überlebender (Nie wieder!), grüner Grillwurstver(z)ehrer und punkto Gewandung leider etwas bieder. Ich arbeite halbtags im Homeoffice und bin trotz Halbtax kein Halbierungs-Initiant.
Ich bin Journalist und Jasser (und Verbissene-Jasser-Hasser), in einer Kommission engagiert, katholisch sozialisiert, nur leicht gläubig, mein Haar hat Lücken, ich bin Luzerner von Geburt und Wünnewiler aus freien Stücken. Ich bin Migros-Kind mit Volgmärkli-Sammelheft, Naturgarten-Heger, Nagetier-Pfleger und Neophyten-Jäger.
Ich bin ordnungsliebender Organspender (das Herz am rechten Fleck) und ornithologisch interessierter Omeletten-Wender. Ich bin Papa. Ich bin peinlich. Ich bin Raketenglacelutscher, Servelaschäler, Steuerzahler und schlafloser Schäfchenzähler. Ich bin Träumer, Tänzer (viel zu selten, findet meine Frau) und Turnvereinschwänzer (sorry an dieser Stelle), UHT-Milch-Verächter und Vollzeitmensch mit Teilzeitstelle.
Ich wein bei Waldhornklängen, aber nicht beim Xylophon. «Yak» ist mein Zauberwort bei «Stadt, Land, Fluss», ich lese Zeitung auf Papier– und die Zungenwurst toppt der Zungenkuss.
Wie sieht Ihr Persönlichkeits-ABC aus? Schreiben Sie es auf. Und wenn Sie das nächste Mal im diskursiven Schützengraben sitzen, denken Sie daran: Ihr Gegenüber liebt vielleicht wie Sie Landjäger, spielt Tschau Sepp oder heult bei Céline Dion. Man wird sich deswegen nicht plötzlich einig über Steuern oder die richtige Menge Knoblauch im Hummus. Aber man diskutiert ganz anders, wenn man weiss: Gegenüber sitzt kein Etikett, sondern ein ganzes Alphabet.
Bild generiert mit ChatGPT